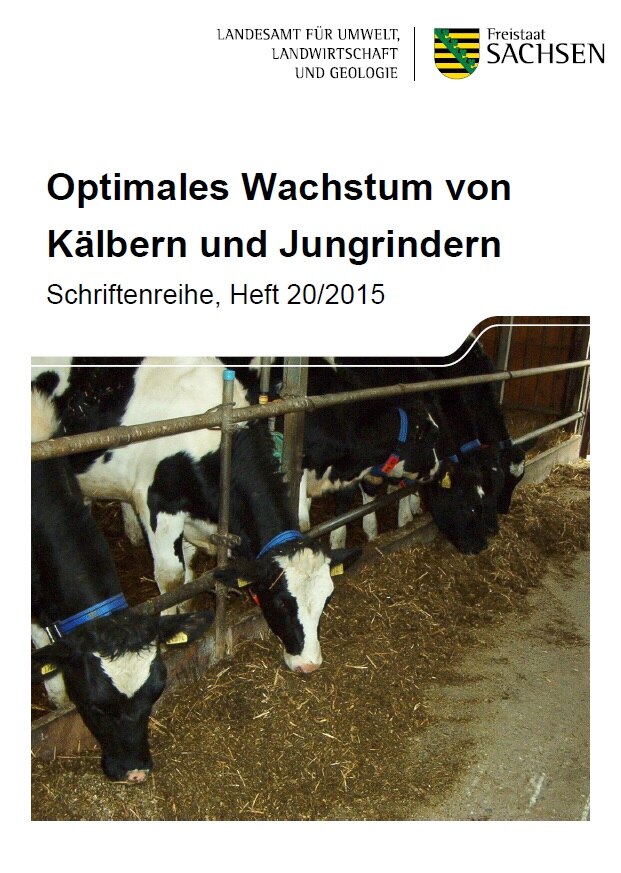Optimierung des Wachstumsverlaufes in der Kälber- und Jungrinderaufzucht zur Verbesserung von Gesundheit, Fruchtbarkeit und Nutzungsdauer in der Milchrindhaltung
Projektlaufzeit 01/2004 - 12/2013
Projektziel:
Empfehlungen zur Optimierung des Kälber- und Jungrinderwachstums in Hinblick auf die Verbesserung der Gesundheit und Langlebigkeit der laktierenden Milchkuh:
- Prüfung Auswirkung von drei verschiedenen Fütterungsintensitäten vom 4. Monat bis zur ersten Besamung
- Begleitende Untersuchung der unterschiedlich intensiv aufgezogenen Rinder bis zur 3.Laktation
- Erprobung von Weidehaltungsverfahren für Jungrinder ab 7. Monat im Vergleich zur Stallhaltung
- Nutzung der Bewegungsaktivität von Jungrindern zur Brunsterkennung in Stall- und Weidehaltungsverfahren
Projektergebnisse:
- Gesundheit und das Wachstum von Kälbern in den ersten Lebenswochen beeinflusst signifikant die Gesundheit, Fruchtbarkeit und Leistungsfähigkeit der Jungkühe in der ersten Laktation. Erreichen die Zunahmen erkrankungsbedingt oder aufgrund unzureichender Bedarfsdeckung <600 g / Tag, besteht ein deutlich höheres Risiko für eine hohe Zwangsabgangsrate dieser Tiere sowohl in der Aufzucht wie auch in der Laktation.
- Eine hohe Aufzuchtintensität ab dem 6. Lebensmonat bis zur Konzeption von > 900 g Körpermassezunahme/Tag führt zu einer verminderten Fruchtbarkeit der Jungrinder, höheren Kälberverlusten wären der ersten Kalbung, höherer Stoffwechselbelastung im geburtsnahen Zeitraum und der Frühlaktation, einer geringeren Nutzungsdauer und Lebensleistung.
- Die Belegung der Jungrinder muss Körpermasseorientiert in Abhängigkeit des realisierten täglichen Körpermassezuwachs erfolgen. Eine Überschreitung des optimalen Bedeckungszeitpunktes erhöht den Fettansatz und damit das Risiko für Stoffwechselimbalancen in der Frühlaktation.
- Phasen, in denen das Wachstum bewusst oder ungewollt gedrosselt wird, können vom Jungrind quantitativ kompensiert werden. Durch die Verlagerung der intensiveren Wachstumsphase in spätere Alters- und Entwicklungsabschnitte ist eine qualitative Kompensation aber eher fraglich.
- In der Trächtigkeit sollten die Färsen weniger als 800 g Körpermassezuwachs / Tag realisieren. Anderenfalls ist mit zu hohem Fettansatz zu rechnen. Eine Konditionierung über Weideperioden hat sich positiv auf die Stabilität der Tiere in der Frühlaktation ausgewirkt.
- Weidehaltung kann positiv auf Gesundheit, Fruchtbarkeit und Leistungsbereitschaft der Jungkühe wirken und damit Lebensleistung und Nutzungsdauer positiv beeinflussen. Mähstandweiden sind auch an Standorten mit ausgeprägter Frühsommertrockenheit in der Lage, Wachstumsraten von 700 – 800 g täglicher Zunahme zu ermöglichen. An die Weidehaltung anschließende Stallhaltungsphasen bergen das Risiko des kompensatorischen Wachstums mit der Gefahr zu starker Fetteinlagerung.
- Die Bewegungsaktivität kann auch bei Jungrindern mit sehr gutem Erfolg für die Brunsterkennung genutzt werden. Auf der Weide haben sich Systeme mit Halsbandrespondern durch die hohe Grundaktivität der Tiere nicht bewährt.
Kontakt
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Referat 74: Tierhaltung
Dr. Ilka Steinhöfel
Telefon: 034222 46-2212
Telefax: 034222 46-2099
Partner im Projekt
Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern
Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau Sachsen-Anhalt, Zentrum für Tierhaltung Iden
Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung Brandenburg
Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft